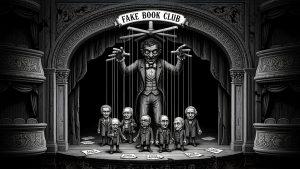Der innere Oberlehrer meldet sich zu Wort
Du kennst das sicher auch: Du scrollst durch Instagram, Twitter oder LinkedIn und stolperst über Profile wie „Max_Mustermann_Autor“ oder Websites wie „Sabine-Schmidt-Autorin.de“. Und jedes Mal – wirklich jedes verdammte Mal – zuckt etwas in mir zusammen. Mein innerer Oberlehrer räuspert sich, schiebt die imaginäre Brille zurecht und fragt in diesem unerträglich dozierenden Tonfall: „Autor? Autor von was denn bitte?“
Ich weiß, ich weiß. Das klingt pedantisch. Vielleicht sogar ein bisschen nach Besserwisserei der übelsten Sorte. Aber bevor du jetzt genervt wegklickst: Diese kleine sprachliche Marotte hat durchaus ihre Berechtigung. Und sie führt uns zu einer interessanten Frage, die uns alle betrifft, die wir mit Worten jonglieren, Geschichten erzählen oder Sachverhalte zu Papier bringen: Was sind wir eigentlich?
Machen wir uns nichts vor: Die Bezeichnung, die wir uns selbst geben, ist mehr als nur ein Label. Sie ist Teil unserer professionellen Identität, unserer Selbstwahrnehmung und – nicht zu unterschätzen – unserer Außenwirkung. Also schauen wir doch mal genauer hin.
„Autor“ – oder: Die Sache mit der Urheberschaft
Fangen wir mit dem Übeltäter an, dem allgegenwärtigen „Autor“. Das Wort stammt vom lateinischen „auctor“ ab, was so viel bedeutet wie „Urheber“, „Schöpfer“ oder „Verursacher“. Schon die alten Römer verwendeten es nicht als Berufsbezeichnung, sondern als Hinweis auf eine Urheberschaft. Der „auctor legis“ war der Urheber eines Gesetzes, der „auctor belli“ der Verursacher eines Krieges.
Das Entscheidende dabei: Das Wort „Autor“ funktioniert wie ein Pfeil, der auf etwas zeigt. Es braucht ein Objekt, ein Werk, auf das es sich bezieht. Ich bin nicht einfach „Autor“ – ich bin der Autor meines Romans „Brumm!“. Genauso wie Hemingway nicht einfach „Autor“ war, sondern der Autor von „Der alte Mann und das Meer“.
Stell dir vor, jemand würde sich als „Besitzer“ vorstellen. Deine erste Frage wäre doch: „Besitzer wovon?“ Eines Hamsters? Einer Yacht? Der größten Sammlung von Star-Trek-Memorabilia nördlich der Alpen? Genauso verhält es sich mit „Autor“.
Die eleganten Auswege
Natürlich gibt es Möglichkeiten, das Wort „Autor“ sinnvoll zu verwenden, ohne dass mein innerer Oberlehrer hyperventiliert:
- Mit Genreangabe: „Krimiautor“, „Fantasy-Autorin“, „Sachbuchautor“ – das funktioniert wunderbar. Hier wird das fehlende Objekt durch die Gattung ersetzt.
- Mit Gattungsbezug: „Buchautor“, „Drehbuchautor“, „Spieleautorin“ – auch das ergibt Sinn.
- Mit konkretem Werk: „Autor von [Buchtitel]“ – die klassische Variante.
Aber das nackte, einsame „Autor“ in der Instagram-Bio? Das ist wie ein Satz ohne Verb – es fehlt einfach was Entscheidendes.
Die Alternativen – Ein ganzer Werkzeugkasten voller Bezeichnungen
Die gute Nachricht: Die deutsche Sprache ist in dieser Hinsicht erstaunlich reich bestückt. Wir haben einen ganzen Werkzeugkasten voller Bezeichnungen für Menschen, die professionell mit Worten arbeiten. Die weniger gute Nachricht: Jede davon hat ihre eigenen Konnotationen, Traditionen und manchmal auch Tretminen.
Der Schriftsteller – der Klassiker
„Schriftsteller“ ist sozusagen der Mercedes unter den Schreibenden-Bezeichnungen: solide, etabliert, ein bisschen konservativ. Der Begriff umfasst alles von Romanen über Kurzgeschichten bis hin zu Sach- und Fachbüchern. Er ist die sicherste Wahl, wenn du dich nicht festlegen willst.
Allerdings – und hier wird’s interessant – haftet dem Begriff auch etwas Erhabenes an. „Schriftsteller“ klingt nach Literaturnobelpreis, nach bedeutungsschweren Werken, nach jemandem, der morgens im Tweedsakko an den Schreibtisch tritt. Für die Verfasserin von Vampir-Romanzen oder den Autor von „Windows 11 für Dummies“ mag das ein bisschen hochgegriffen wirken. Aber wer sagt denn, dass wir uns nicht ein bisschen Würde gönnen dürfen?
Der Dichter – für die gehobenen Ansprüche
Apropos Würde: Der „Dichter“ spielt in einer noch höheren Liga. Ursprünglich bezog sich der Begriff tatsächlich nur auf die Dichtung, also Poesie und Lyrik. Goethe war ein Dichter. Schiller auch. Heute verwenden wir den Begriff breiter für fiktionale Literatur allgemein („Dichtung und Wahrheit“), aber immer noch mit diesem Unterton von künstlerischem Anspruch.
Sich selbst als „Dichter“ zu bezeichnen, ist ein bisschen wie sich selbst zum Genie zu erklären: Selbst wenn’s stimmt, wirkt’s komisch. Das überlässt man besser anderen.
Der Poet – der Spezialist
Der „Poet“ ist da schon spezifischer: Er schreibt Gedichte, Songtexte, vielleicht auch mal einen gereimten Geburtstagsgruß für Tante Erna. Das ist ehrliches Handwerk, oft unterschätzt, aber klar definiert. Wenn du dich „Poet“ nennst, weiß jeder, was Sache ist.
Der Romancier – französisch und fokussiert
„Romancier“ klingt sophisticated, ein bisschen nach Pariser Café und Gauloises. Es ist die perfekte Bezeichnung, wenn du ausschließlich Romane schreibst und das auch betonen möchtest. Der Begriff hat etwas Professionelles, ohne überheblich zu wirken.
Die problematischen Verwandten
Dann gibt’s noch die Bezeichnungen, bei denen Vorsicht geboten ist:
- „Schreiber“ klingt nach mittelalterlichem Skriptorium oder nach jemandem, der Protokolle tippt. Nicht gerade das, was man sich für seine Autorenvita wünscht.
- „Schreiberling“ ist definitiv negativ besetzt – das ist der nervige Typ, der ständig unveröffentlichbare Manuskripte produziert und allen davon erzählt.
Die kreativen Lösungen – oder: Warum nicht mal was Neues?
Jetzt wird’s spannend. Denn wer sagt eigentlich, dass wir uns auf die traditionellen Bezeichnungen beschränken müssen? Sprache lebt, entwickelt sich, und manchmal darf man auch ein bisschen kreativ werden.
Ich selbst experimentiere gerne mit verschiedenen Bezeichnungen, je nach Kontext:
- „Geschichtenerzähler“ für meine fiktionalen Projekte – das hat was Ursprüngliches, Archaisches. Es erinnert an Lagerfeuer und mündliche Überlieferung.
- „Worteschmied“ für meine Arbeit als Texter – ein bisschen handwerklich, ein bisschen poetisch.
- „Textarbeiter“ wenn’s um Übersetzung, Redaktion und Korrektorat geht – ehrlich und ohne Schnörkel.
Und dann gibt’s noch die wunderbar simple Variante: „Schreibende“ oder „Schreibender“. Das ist wie diese skandinavischen Möbel – reduziert auf’s Wesentliche, aber gerade deshalb elegant. „Amalia Analogie – Schreibende“ macht auf einer Visitenkarte durchaus was her.
Die Krux mit der Selbstbezeichnung
Hier kommen wir zum eigentlichen Knackpunkt: Die Wahl unserer Berufsbezeichnung ist immer auch ein Balanceakt zwischen Selbstbewusstsein und Bescheidenheit, zwischen Anspruch und Realität.
Nennt sich die Hobbyschreiberin, die gerade ihr erstes Manuskript beendet hat, schon „Schriftstellerin“? Darf sich der Self-Publisher mit drei veröffentlichten E-Books „Romancier“ nennen? Ab wann wird aus dem „angehenden Autor“ ein echter?
Die unbequeme Wahrheit: Es gibt keine offizielle Stelle, die dir ein Zertifikat ausstellt. Kein Amt für Schriftstellerangelegenheiten, das dir erlaubt, dich so oder so zu nennen. Das ist Fluch und Segen zugleich.
Mein Vorschlag: Wähle die Bezeichnung, die sich für dich richtig anfühlt UND die du nach außen vertreten kannst. Wenn du Geschichten schreibst, darfst du dich Geschichtenerzähler nennen. Wenn du Romane verfasst, bist du Romancier. Wenn du Texte produzierst, bist du… nun ja, vielleicht nicht „Textproduzent“ (das klingt nach Fließband), aber du verstehst, worauf ich hinaus will.
Der praktische Leitfaden für deine Profilbeschreibung
Kurzum: Für deine Social-Media-Profile, deine Website oder deine Visitenkarte empfehle ich folgende Hierarchie:
- Spezifisch und selbstbewusst: „Krimiautor“, „Science-Fiction-Autorin“, „Romancier“
- Klassisch und solide: „Schriftsteller“, „Schriftstellerin“
- Modern und unprätentiös: „Schreibende“, „Schreibender“
- Kreativ und individuell: „Geschichtenerzähler“, „Worteschmied“ (aber Vorsicht vor zu viel Kitsch)
Was du vermeiden solltest:
- Das nackte „Autor“ ohne weitere Spezifikation
- Übertrieben hochgegriffene Bezeichnungen („Literat“, „Dichter“), es sei denn, sie passen wirklich
- Negative oder abwertende Begriffe („Schreiberling“, selbst ironisch gemeint)
Fazit
Am Ende ist es wie mit allem beim Schreiben: Die Form sollte dem Inhalt folgen, nicht umgekehrt. Wähle eine Bezeichnung, die zu dem passt, was du tust und wie du dich dabei fühlst. Und wenn mein innerer Oberlehrer mal wieder aufmuckt, wenn ich „Max_Mustermann_Autor“ lese, dann ist das mein Problem, nicht deins.
Aber vielleicht – nur vielleicht – denkst du beim nächsten Profilupdate kurz darüber nach, ob „Krimiautor“ oder „Geschichtenerzähler“ nicht doch die schickere Variante wäre. Dein Profil wird’s dir danken. Und mein innerer Oberlehrer auch.
Und wer bist du?
Was ist deine Lieblings-Berufsbezeichnung? Habe ich eine wichtige Variante vergessen? Und wie stehst du zum nackten „Autor“? Lass es mich in den Kommentaren wissen – ich bin gespannt auf eure kreativen Selbstbezeichnungen!