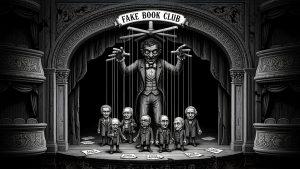Manuskripte korrigieren – aber richtig
Du kennst das: Das Manuskript ist fertig, die Geschichte steht, der Inhalt sitzt. Eigentlich könnte es losgehen mit der Veröffentlichung. Eigentlich. Denn da lauert noch dieser eine Endgegner, der schon so manche Schreibenden zur Verzweiflung getrieben hat: die Fehlerkorrektur. Rechtschreibfehler, Kommafehler, Grammatikpatzer – sie alle verstecken sich wie kleine Saboteure in deinem Text und warten nur darauf, von deinen Lesern entdeckt zu werden. Peinlich? Definitiv. Vermeidbar? Absolut!
Der Mythos der hundertprozentigen Fehlerfreiheit
Machen wir uns nichts vor: Wer dir verspricht, dein Manuskript zu 100 Prozent fehlerfrei zu machen, der verkauft dir Schlangenöl. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren – professionelle Korrektur für Fiktion, Sachtexte und Unternehmenskommunikation – und selbst mit all dieser Erfahrung würde ich niemals behaupten, jeden einzelnen Fehler zu erwischen. Das kann niemand. Auch die neuesten KI-Tools nicht, so sehr sie auch damit prahlen mögen.
Warum? Ganz einfach: Auch diese Tools sind von Menschen gemacht. Und Menschen machen Fehler. Selbst Korrektoren. Gerade Korrektoren, möchte ich manchmal sarkastisch anmerken, wenn ich einen eigenen Tippfehler in einer Mail an einen Kunden entdecke. Die Betriebsblindheit ist eine hartnäckige Gesellin – aber dazu demnächst einen Artikel.
Die gute Nachricht: Mit einem systematischen Arbeitsprozess lässt sich die Fehlerquote drastisch senken. Die weniger gute Nachricht: Es bedeutet Arbeit. Viel Arbeit. Aber es lohnt sich.
Der Korrekturprozess: Acht Schritte zum Fehlerminimum
Schritt 1: Das Glossar – Dein Rettungsanker in der Konsistenz
Bevor ich auch nur einen einzigen Rechtschreibfehler korrigiere, erstelle ich ein Glossar. Namen, Orte, Fachbegriffe – alles kommt rein. Besonders interessant wird es bei bewussten Abweichungen von den Duden-Empfehlungen. Schreibt jemand konsequent „Delphin“ statt „Delfin“ oder „Portrait“ statt „Porträt“? Gendert jemand? Nutzt Neopronomina? All das muss dokumentiert werden, sonst hast du am Ende einen bunten Mix, der unprofessioneller wirkt als der eine oder andere Tippfehler.
Hier kommt übrigens die vielgescholtene KI ins Spiel – wenn der Kunde es erlaubt. Die großen Language Models sind verdammt gut darin, solche Listen zu erstellen. Sie finden jeden Namen, jeden Ort, jede Auffälligkeit. Natürlich muss man das Ergebnis überprüfen, aber als Ausgangspunkt? Goldwert!
Schritt 2: Die Freigabe – Vier Augen sehen mehr als zwei
Diese Glossar-Liste ist kein Geheimnis, das ich für mich behalte. Sie geht direkt an den Kunden zur Freigabe. Warum? Weil niemand die Intention des Textes besser kennt als der Autor selbst. Vielleicht hat die Protagonistin ja absichtlich einen ungewöhnlich geschriebenen Namen. Vielleicht ist „das Voto-Wolta’sche Gesetz“ eine bewusste Anspielung. Kommunikation ist hier der Schlüssel.
Schritt 3: Die Nachverfolgung – Transparenz ist Trumpf
Jetzt wird’s technisch: Die „Änderungen nachverfolgen“-Funktion in Word ist mein bester Freund. Bei eigenen Texten nutze ich sie, um am Ende nochmal alle Korrekturen durchgehen zu können. Bei Kundentexten ist sie unverzichtbar: Der Kunde sieht jede einzelne Änderung und kann sie annehmen oder ablehnen. Besonders bei Grammatik-Korrekturen, wo ich manchmal tiefer in die Satzstruktur eingreifen muss, ist das essentiell. Niemand mag Überraschungen, wenn es um seinen Text geht.
Schritt 4: Der Duden-Korrektor – Die erste Verteidigungslinie
79 Euro netto für den Duden Korrektor 15 für Microsoft Office. Nicht gerade ein Schnäppchen, aber meiner Meinung nach die beste verfügbare Rechtschreibprüfung für Deutsch auf dem Markt. Der digitale Duden findet Fehler, die dem menschlichen Auge entgehen – besonders diese fiesen Tippfehler, wo aus „sie“ ein „sei“ wird oder aus „dem“ ein „den“. Alles richtige Wörter, nur eben im falschen Kontext.
Schritt 5: Der Rückwärtsgang – Gegen den Strom lesen
Jetzt wird’s unkonventionell: Der erste manuelle Korrekturgang startet auf der letzten Seite. Ich arbeite mich von hinten nach vorne durch das Manuskript. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber genau darum funktioniert es. So werde ich nicht von der Handlung mitgerissen, verliere mich nicht in der Geschichte. Der Text wird zur reinen Ansammlung von Wörtern und Sätzen, die auf Fehler überprüft werden müssen.
Pro-Tipp aus der Praxis: Lies dir den Text laut vor, Silbe für Silbe. Ja, du klingst dabei wie ein Erstklässler, der gerade lesen lernt. Ja, deine Familie wird dich für verrückt halten. Aber du nimmst jedes einzelne Wort wahr, nicht nur Wortcluster. „Zu-sam-men-ge-setzt-e Sub-stan-ti-ve“ werden plötzlich zu einzelnen Bausteinen, die du auf Rechtschreibung überprüfen kannst.
Schritt 6: Der Vorwärtsgang – Mit frischen Augen
Zweiter manueller Durchgang, diesmal von vorne nach hinten. Warum nochmal? Weil dein Gehirn nach der Rückwärtslektüre wieder resettet ist. Du siehst andere Fehler, bemerkst andere Ungereimtheiten. Es ist wie bei diesen optischen Täuschungen: Je nachdem, wie du draufschaust, siehst du verschiedene Dinge.
Schritt 7: Language Tool – Die KI-Verstärkung
Nach der manuellen Arbeit kommt nochmal digitale Unterstützung: Language Tool, ein KI-basiertes Prüfwerkzeug, das besonders gut darin ist, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler zu finden. Aber auch Formatierungsfehler wie inkonsistente Anführungszeichen oder falsche Gedankenstriche entgehen ihm nicht. Die kostenlose Version reicht für kürzere Texte, bei Romanen lohnt sich die Pro-Version.
Schritt 8: Die Endkontrolle – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Alle markierten Fehler gehe ich nochmal durch. Denn nicht nur ich, sondern auch die Tools machen Fehler: Manchmal markieren sie Dinge als falsch, die völlig in Ordnung sind. Besonders bei stilistischen Eigenheiten oder bewussten Regelbrüchen in Dialogen muss man aufpassen.
Und wenn eine Korrektur nicht selbsterklärend ist? Dann hinterlasse ich einen Kommentar. „Hier fehlt meiner Meinung nach ein Komma, aber der Satz funktioniert auch ohne“ oder „Das Wort gibt es laut Duden nicht, aber im Kontext macht es Sinn“ – solche Hinweise helfen dem Autor, informierte Entscheidungen zu treffen.
Was ein Korrektor macht – und was nicht
Als Korrektor kümmere ich mich um Rechtschreib-, Grammatik-, Zeichensetzungs- und Semantikfehler. Punkt. Ausdruck und Stil rühre ich nur an, wenn ein gefundener Fehler diese beeinflusst. Der Inhalt? Nicht mein Bier. Obwohl ich es meine Kunden schon wissen lasse, wenn mir ein Text gefällt – positive Verstärkung hat noch niemandem geschadet.
Das ist wichtig zu verstehen: Korrektur ist nicht Lektorat. Korrektur ist nicht Überarbeitung. Korrektur ist die chirurgische Entfernung von Fehlern, nicht die kreative Neugestaltung des Textes. Diese Trennung muss glasklar sein, sonst kommst du durcheinander. Glaub es dem gebrannten Kinde.
Die Dokumentation – Dein Sicherheitsnetz
Nach jedem einzelnen Korrekturschritt speichere ich eine Sicherungskopie. Version_1_nach_Glossar, Version_2_nach_Duden, Version_3_nach_erster_manueller_Korrektur – du verstehst das Prinzip. Paranoid? Vielleicht. Aber wenn mal was schiefgeht (und Murphy’s Law gilt auch beim Korrekturlesen), kannst du zurück zum letzten funktionierenden Stand.
Der Do-it-yourself-Ansatz
Du willst selbst korrekturlesen? Respekt! Dann nimm dir mein System als Vorlage. Aber – und das ist ein großes ABER – trenne Überarbeitung und Korrektur streng voneinander. Siehe den Hinweis auf die Unterscheidung von Lektorat und Korrektorat. Ich weiß, bei eigenen Texten ist das verdammt schwer. Da liest du einen Satz und denkst: „Mensch, das könnte ich aber eleganter formulieren.“ Finger weg! Erst korrigieren, dann überarbeiten. Oder andersrum. Aber niemals gleichzeitig.
Der innere Schweinehund wird dir einflüstern: „Ach komm, nur diese eine kleine Änderung.“ Widerstehe! Denn aus einer kleinen Änderung werden zwei, werden zehn, und plötzlich überarbeitest du das halbe Kapitel, während dir die Rechtschreibfehler durch die Lappen gehen.
Die Alternative: Professionelle Unterstützung
Wenn du lieber ein frisches Paar Augen draufschauen lassen möchtest – glaub mir, das ist oft die klügere Entscheidung – und gerade keinen Sprachstreber unter deinen Freund:innen oder in deiner Verwandtschaft hast, dann hol dir professionelle Hilfe. Die Betriebsblindheit bei eigenen Texten ist real. Du kennst deinen Text so gut, dass dein Gehirn die Fehler einfach überliest. Es sieht, was da stehen sollte, nicht was da steht.
Fazit: Perfektion ist eine Illusion, Exzellenz ein erreichbares Ziel
Fehlerfreiheit ist wie der Horizont – je näher du kommst, desto weiter entfernt scheint sie. Aber mit System, Geduld und den richtigen Werkzeugen kannst du verdammt nah rankommen. Die oben beschriebenen acht Schritte sind keine Garantie für Perfektion, aber sie sind eine Garantie für Professionalität.
Und mal ehrlich: Deine Lesenden werden dir den einen oder anderen übersehenen Fehler verzeihen. Was sie dir nicht verzeihen werden, ist Schlampigkeit. Der Unterschied zwischen einem Text mit drei Fehlern auf 300 Seiten und einem mit 30 Fehlern auf 30 Seiten? Der erste zeigt Respekt vor dem Leser, der zweite Gleichgültigkeit.
Also pack es an! Ob mit meiner Hilfe oder im Alleingang – dein Text hat es verdient, in seiner besten Form in die Welt hinauszugehen. Denn am Ende des Tages gilt: Ein gut korrigierter Text ist wie ein gut gebügeltes Hemd – man bemerkt es vielleicht nicht bewusst, aber man spürt den Unterschied.
Kurzum: Korrektorat ist eine Kunst für sich. Mit dem richtigen System wird aus dem Chaos der Fehlersuche ein strukturierter Prozess. Und wenn du merkst, dass du beim dritten Durchlesen deines eigenen Textes nur noch Buchstabensalat siehst? Dann ist es Zeit für professionelle Unterstützung. Dein Text – und deine Leser – werden es dir danken.