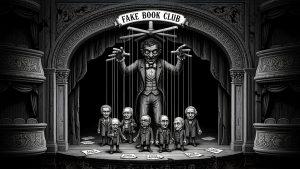Normseiten, wo man nur hinschaut: Verlage und Agenturen verlangen sie (wenn auch nicht mehr ganz so oft), ebenso Institutionen, die Stipendien vergeben. Lektorat und Korrektorat werden danach abgerechnet und auch die VG Wort verwendet sie als Grundlage zur Tantiemenberechnung. Doch was genau ist eine Normseite? Woher stammt sie? Welchen Zwecken dient sie? Und welche anderen Normen für Texte gibt es noch?
Am Anfang war das Wort – oder doch eher der Buchstabe?
Wie lassen sich Textmengen abschätzen? Eine einfache Frage – aber wichtig: Für den Lektor, Redakteur und/oder Verleger, der wissen will, wie viele Druckseiten, wie viele Zeitungsspalten ein Manuskript oder ein Artikel füllt. Für den Journalisten, denn er wird nach Textmenge bezahlt. Für den Schriftsteller, denn ob sein Werk veröffentlicht wird oder auch nicht, hängt auch davon ab, ob es zu lang oder zu kurz ist.
Im angelsächsischen Sprachraum hat man sich auf die Grundeinheit „Wort“ geeinigt. Allerdings ist die durchschnittliche Wortlänge im Englischen (ca. 5,1 Buchstaben) kürzer als im Deutschen (5,9 Buchstaben). Und die Wortlänge ist auch weniger heterogen: So verzeichnet das längste in englischen Wörterbüchern verzeichnete Wort gerade einmal 45 Buchstaben – „Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis“. Der längste nicht-technische Begriff („antidisestablishmentarianism“) hat sogar nur 28 Buchstaben.
Im Deutschen, ach je: Das bekannte (wenn auch inzwischen abgeschaffte) „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“ hat 63 Buchstaben, die „Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft“ bringt es sogar auf 80. Dies mögen Extrem-Beispiele sein, doch die Eigenschaft, der deutschen Sprache, beliebig komplexe Komposita zu erlauben, lässt die Wortlänge eher heterogen werden – um es behutsam auszudrücken. In jedem Fall sind wir im Scrabble unschlagbar.
Daher bietet es sich an, den Blick auf die Zeichenmenge zu richten. Allerdings sind 525.321 Zeichen als Längenangabe weniger aussagekräftig als beispielsweise 350 Seiten. Allein: Wie viele Zeichen passen denn nun auf eine Seite? Jeder, der schon mal mit einem Textverarbeitungsprogramm herumgespielt hat (und/oder für eine Hausarbeit so lange die Schrift verkleinert oder vergrößert, bis die vorgeschriebene Seitenzahl erreicht wurde), weiß: praktisch beliebig viele oder wenige Zeichen – je nach Font und Schriftgröße. Hinzu kommt, dass sogenannte Proportionalschriften wie Times Roman selbst bei einer gut lesbaren Schriftgröße wie 12 pt sehr heterogene Ergebnisse produzieren, da Zeichen in diesen Schriften unterschiedlich breit sind. „Jilitili“ und „Warmname“ sind beide acht Buchstaben lang, belegen jedoch unterschiedlich viel Platz in einer Zeile.
Die Lösung: Eine Festbreitenschrift (= alle Zeichen sind gleich breit), eine festgelegte Zeilenlänge und eine ebenso festgelegte Anzahl von Zeilen pro Seite. Ein lösbares Problem? Nun, wir können froh sein, dass dieses Problem schon vor der Ankunft moderner Textverarbeitungssysteme und vor allem vor dem Aufstieg der Social Media angegangen und gelöst wurde – sonst würden die Streitereien noch immer andauern. Man orientierte sich damals – an der Schreibmaschine. Und die Normseite war geboren.
Ausgangspunkt Schreibmaschine
Wer kennt sie noch oder schreibt gar damit – die mechanische Schreibmaschine? Ja, es gibt Schreibende, die damit ihre Erstfassungen schreiben. Wie dem auch sei: Auf eine Schreibmaschinenseite passten – wenn man das Papier nur ordentlich einspannte, 30 Zeilen mit doppeltem Zeilenabstand. Wollte man dann noch anständige Ränder (etwa zwei Zentimeter links, um das Dokument gut lochen und abheften zu können, etwa 3,5 Zentimeter rechts – ausreichend für Korrekturen) haben, blieb eine Zeilenlänge von maximal 60 Zeichen (oder Anschlägen, was aber nichts mit Terrorismus zu tun hat, sondern mit der Kraft, die es benötigte, eine Schreibmaschinentype auf das Papier zu hämmern).
Und diese 30 Zeilen à 60 Zeichen – die sind heute noch immer die Norm aller Dinge.
Ein Caveat: Zwar fasst so eine Seite theoretisch 30*60 = 1800 Zeichen, allerdings schöpft eine durchschnittliche Seite diese Zeichenzahl eher selten aus: Umbrüche und unterschiedliche Zeilenlängen aufgrund von Wortlängen sind der Standard. Daher rechnet man mit 1600 Zeichen/Normseite. Die VG Wort verwendet sogar nur 1500 Zeichen.
Die Normseite
In einer modernen Textverarbeitung ist eine Normseite schnell eingerichtet.
Eine Festbreitenschriftart, etwa die auf allen gängigen Systemen präsente Courier New, Schriftgröße 12, doppelter Zeilenabstand, oben und unten je ein Rand von zwei Zentimetern, rechts ein Rand von 3,5 Zentimetern – das sollte schon passen. Will man noch eine Kopf- oder Fußzeile unterbringen, muss man den jeweiligen Rand verbreitern und dann den Zeilenabstand so lange anpassen, bis wieder dreißig Zeilen auf die Seite passen.
Zum Test kann man
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
in eine Zeile schreiben und diese Zeile dann neunundzwanzigmal kopieren. (29? Ja. Eine Zeile steht da ja schon.) Nun könnt ihr herumprobieren, bis alles passt.
Wichtig ist auch, dass ihr euer Absatzformat anpasst: Flattersatz. Silbentrennung deaktiviert. Vor und nach dem Absatz 0pt. Das gilt auch für Überschriften (die allerdings zentriert sein dürfen). Wollt ihr eine Zäsur setzen, dann müsst ihr einfach einen Zeilenumbruch einfügen.
Textauszeichnungen wie fett, kursiv, unterstrichen sind ebenfalls erlaubt. Auf Hoch- und Tiefstellen solltet ihr allerdings verzichten. Ebenfalls zur Auszeichnung erlaubt sind zudem (zumindest theoretisch) GROSSBUCHSTABEN und S p e r r u n g, bei Letzterem unbedingt darauf achten, dass der Abstand wirklich ein Leerzeichen umfasst.
Eher im Journalismus gebräuchlich sind zudem Zeilennummern, üblicherweise in 5er-Schritten. Bei MS Word findet ihr diese Option in der Registerkarte „Layout“.
Und fertig ist die Normseite. Speichert sie gleich als Vorlage ab – und ihr könnt sie jederzeit nutzen.
Tabellarische Übersicht
| Schrifttyp und Größe | Courier New, 12 pt. |
| Zeilenabstand | 1.5 bis 2.0-fach (sodass 30 Zeilen auf die Seite passen) |
| Textbreite | 60 Zeichen |
| Linker Rand | 2 cm |
| Rechter Rand | 3,5 cm |
| Oberer und unterer Rand je | 2,5 cm (oder anpassen, bis die 30 Zeilen auf die Seite passen) |
| Absatzformat | Flattersatz. Keine Silbentrennung. Abstand oben und unten 0pt. |
| Textauszeichnungen | fett, kursiv, unterstrichen, GROSSBUCHSTABEN und S p e r r u n g |
Ich habe übrigens eine Vorlage für WORD erstellt, die ihr hier nach kostenloser Registrierung herunterladen könnt.
Darum solltet ihr die Normseite verwenden
Es gibt gleich mehrere Gründe, warum ihr euer Manuskript vor der Abgabe in Normseiten umformatieren solltet – schreiben solltet ihr euer Meisterwerk so, wie es euch am angenehmsten ist.
- Verlage, Agenturen und auch Institutionen, die Stipendien vergeben, schreiben die Normseite oft explizit vor. Und das ist der erste Filter, auf den ihr trefft: Erfüllt euer Manuskript diese Vorgabe nicht, wird es höchstwahrscheinlich aussortiert.
- Selbst wenn eine solche Formatierung nicht explizit vorgeschrieben ist: Erstlesende und Lektoren kennen das Normseitenformat – und damit euch als Schreibenden, der sich mit seinem Handwerk auseinandergesetzt hat: ein weiterer Pluspunkt.
- Zudem hat jeder Verlag eine Formel, mit der sie Normseiten in gedruckte Buchseiten umrechnen können. Sie wissen: Die Druckseite ihres Standard-Layouts entspricht einer, anderthalb, zwei Normseiten. So können sie allein von der Seitenzahl den Druckaufwand und die Kosten kalkulieren – zumindest überschlagsmäßig.
- Aber auch als Selfpublisher profitiert ihr von der Umwandlung in Normseiten: Lektorate, Korrektorate, Layout-Arbeiten – diese werden sehr häufig nach Normseiten abgerechnet.
- Und nicht zuletzt gibt euch die Normseite eine weitere Möglichkeit, euer Manuskript zu verbessern, denn durch diese massive Veränderung des Erscheinungsbildes lest ihr den Text mit anderen Augen.
Und zuletzt: Welche Normen gibt es noch?
Neben der Normseite gibt es auch die Normzeile in zwei Varianten. Für Lektorat und Korrektorat, das nach Zeilen abgerechnet wird, ist die Normzeile 60 Zeichen lang, für Übersetzungen hingegen 55 Zeichen. Fragt mich nicht warum.
Und nicht zuletzt haben Zeitungen und Zeitschriften eigene Normzeilen, die sich aber an der durchschnittlichen Spaltenbreite des jeweiligen Mediums ausrichten und 25, 30 oder 35 Zeichen umfassen können. Euer Ansprechpartner sagt euch das denn schon. Einige Redaktionen bieten sogar passende Vorlagen.
Okay, war dieser Artikel für euch hilfreich? Welche anderen Themen wünscht ihr euch noch? Lasst es mich wissen. In den Kommentaren. Oder per Mail an helmut@writing-rules.com.